| Wird Ihnen dieser Newsletter nicht richtig angezeigt? Zur Webseitenansicht |
|
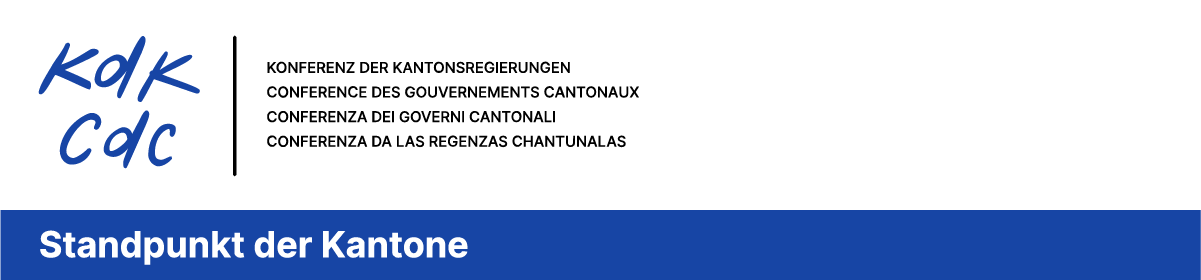 |
|
| Sehr geehrte Damen und Herren
Viele Jahre lang zögerte der Bund, das Problem der Heiratsstrafe anzugehen, obwohl es auf Kantonsebene durch das Splitting bereits auf bewährte Weise gelöst war. Nun wird vorgeschlagen, zur Lösung des Problems auf Bundesebene die Individualbesteuerung einzuführen. Für die Kantone ist dies unnötig: Die Individualbesteuerung führt zu viel administrativem Aufwand und zu einer grundlegenden Umwälzung unseres gesamten Steuersystems, vom Bund auch für alle Kantone zwingend verordnet, obwohl die Kantone die Heiratsstrafe bereits abgeschafft haben. Aus diesem Grund haben zehn Kantone das Referendum ergriffen. Die Konferenz der Kantonsregierungen empfiehlt, das neue Gesetz abzulehnen.
Auch die Volksinitiative «200 Franken sind genug!» führt in die falsche Richtung. Durch den Angriff auf die Radio- und Fernsehabgabe gefährdet sie die Finanzierung und damit der Betrieb der SRG sowie zahlreicher regionaler Sender wie wir sie heute kennen. Die verschiedenen Regionen des Landes laufen Gefahr, nicht mehr mit hochwertigen lokalen Informationen versorgt zu werden. Aus diesem Grund rufen wir dazu auf, ein NEIN in die Urne zu legen.
Bei der Digitalen Verwaltung Schweiz (DVS) sind der Bundesrat und die Kantonsregierungen dabei, gemeinsam festzulegen, welche Rolle diese Organisation in Zukunft spielen soll. Die DVS ist ein Beispiel einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden. In der Rubrik «Fokus» finden Sie einen Überblick über die wichtigsten laufenden Vorhaben.
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie der Arbeit der Kantone entgegenbringen, und wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.
Regierungsrat Markus Dieth
Präsident der KdK
| |
|
|
|
| | | | Plenarversammlung vom 19. Dezember 2025 | | | | |
|
|
| | Korrektur der Heiratsstrafe: keine komplette Umwälzung des Systems notwendig | | Die Konferenz der Kantonsregierungen ist gegen die Einführung der Individualbesteuerung. Die Heiratsstrafe könnte korrigiert werden, ohne das System für die Besteuerung von Ehepaaren von Grund auf zu ändern. Die Kantone haben dies in der Vergangenheit mit der Umstellung auf ein Splitting-Modell oder mit geeigneten Steuertarifmassnahmen bewiesen. Das vom Bund nun vorgelegte Gesetz schiesst über das Ziel hinaus und droht, erhebliche Kosten und Mindereinnahmen zu verursachen. Zum zweiten Mal in der Geschichte haben deshalb zehn Kantonsregierungen das Kantonsreferendum ergriffen, damit die Bevölkerung am 8. März 2026 darüber abstimmen kann.
Die Individualbesteuerung würde zu einem schweren und unnötigen Eingriff in die Steuersysteme der Kantone und Gemeinden führen. Diese wären gezwungen, ihre Gesetzgebung, Steuersätze und Steuerabzüge anzupassen und den Zugang zu wichtigen staatlichen Leistungen wie z.B. die Prämienverbilligungen neu zu regeln. Dieser Systemwechsel würde zudem neue Ungleichheiten zulasten von Einverdienerehepaaren sowie Zweiverdienerehepaaren mit geringem Zweiteinkommen schaffen.
» Positionsbezug
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Keine Gefährdung des Service-public-Auftrags der SRG in den Regionen | | Ein starker medialer Service public ist zentral für regionale Information und demokratische Meinungsbildung. Aus dieser Überzeugung lehnt die Konferenz der Kantonsregierungen die Volksinitiative ab, welche die Radio- und Fernsehabgabe für die Haushalte auf 200 Franken senken und für Unternehmen vollständig abschaffen will. Die Plenarversammlung hat mit Blick auf die Volksabstimmung vom 8. März 2026 Stellung zur Initiative «200 Franken sind genug! (SRG‑Initiative)» bezogen. Nach Auffassung der Kantone könnte der audiovisuelle Service public in den Regionen bei einer derart massiven Kürzung nicht mehr ausreichend gewährleistet werden. Die heutige lokale Berichterstattung über Veranstaltungen und die politische Aktualität wäre gefährdet. Eine Annahme der Initiative wäre auch schädlich für den Arbeitsmarkt, weil die SRG in mehreren Regionen der Schweiz eine bedeutende Arbeitgeberin ist.
» Positionsbezug
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Digitale Verwaltung: Gemeinsame Steuerung stärken – neue Kompetenzen prüfen | | Für die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung braucht es einen landesweit koordinierten Ansatz und eine engere Zusammenarbeit aller drei Staatsebenen. Die Plenarversammlung folgte dem Bundesrat und verabschiedete das Zielbild für die künftige Zusammenarbeit im Bereich der digitalen Verwaltung mit zwei strategischen Stossrichtungen: Die erste bezweckt eine Stärkung der gemeinsamen Steuerung sowie der Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden. Dabei wird der Schwerpunkt auf die Bildung zusätzlicher Synergien und die Verbesserung der Interoperabilität dank der gemeinsamen Erarbeitung von Standards gelegt. Die zweite strategische Stossrichtung soll zu einer neuen Bundeskompetenz mit spezifischen Regeln zur Mitwirkung der Kantone und Gemeinden führen, damit wesentliche Standards wie beispielsweise solche für den Datentransfer zwischen Behörden für alle Gemeinwesen verbindlich erklärt werden können.
In einem nächsten Schritt wird ein Gesamtkonzept für die Umsetzung der beiden Stossrichtungen erarbeitet. Nach einer Konsultation soll das Gesamtkonzept 2027 ebenfalls durch den Bundesrat und die KdK verabschiedet werden. Für die Vorbereitung der neuen Bundeskompetenz hat der Bund eine tripartite Kommission eingesetzt, in der Vertretungen von Kantonen und Gemeinden mitwirken.
» Medienmitteilung
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Für eine strukturierte Zusammenarbeit mit dem Europäischen Ausschuss der Regionen | | Die Beziehungen zwischen den Kantonen und dem Europäischen Ausschuss der Regionen sollen intensiviert werden. Der Ausschuss verabschiedete Mitte Oktober einstimmig eine Stellungnahme zur Stärkung der Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz. Darin wird auf die engen Beziehungen zwischen den europäischen Regionen und den Kantonen hingewiesen. Künftig wollen der Europäische Ausschuss der Regionen und die KdK strukturiert zusammenarbeiten, damit bei der Umsetzung und Überwachung der bilateralen Abkommen vermehrt auch regionale Sichtweise berücksichtigt werden. Die Modalitäten dieser Zusammenarbeit werden zurzeit geprüft.
Die Plenarversammlung der KdK befasste sich zudem mit den jüngsten Entscheiden des Bundesrats im Anschluss an das Vernehmlassungsverfahren zum Abkommenspaket Schweiz-EU. Die Kantonsregierungen hatten sich am 24. Oktober zu diesem Geschäft geäussert. Sie befürworten die allgemeine Stossrichtung, die weiterhin in dieser Sache verfolgt wird. Sie begrüssen es, dass der Bundesrat mehrere ihrer Vorschläge übernommen hat, bereit ist, die Kantone stärker in die Fortsetzung der Europapolitik einzubeziehen und Präzisierungen zum Stromabkommen vorgenommen hat (es wird keine Verpflichtungen in Bezug auf Wasserzins, Konzessionen und Heimfall geben). Die Kantonsregierungen werden sich nach der Verabschiedung der Botschaft an die eidgenössischen Räte detaillierter äussern.
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Entlastungspaket 27: Die Kantone ziehen Zwischenbilanz | | Die Plenarversammlung wurde über die Beschlüsse des Ständerats zum Entlastungspaket 2027 des Bundes informiert. Die Kantonsregierungen begrüssen, dass mehrere vom Bundesrat vorgeschlagene Massnahmen abgelehnt oder angepasst wurden. So hat der Ständerat den Sparvorschlag beim Nationalen Finanzausgleich verworfen und ist auf verschiedene Kompromissvorschläge der Kantone eingegangen, wie etwa beim Gebäudeprogramm oder bei Innosuisse. Aus Sicht der Kantonsregierungen sollte der Nationalrat aber dort noch nachbessern, wo es sich nicht um Sparmassnahmen, sondern um reine Lastenabwälzungen auf die Kantone und Gemeinden geht, z.B. im Asylbereich.
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Schwerpunktgeschäfte 2026 der KdK: Europa, Finanzen, Digitalisierung und Integration im Rampenlicht | | Die Plenarversammlung hat für 2026 sechs Schwerpunktgeschäfte definiert: Europapolitik (parlamentarische Beratungen über das Abkommenspaket Schweiz/EU und Konkretisierung der Kantonsbeteiligung), Entlastungspaket 2027 des Bundes (Verfolgung der parlamentarischen Debatten und Haltung zu einem möglichen Referendum), Entflechtung der Aufgaben von Bund und Kantonen (Zwischenbericht), nationaler Finanzausgleich, Integration von Ausländerinnen und Ausländern (neue Grundlagen für die kantonalen Integrationsprogrammen, Umsetzung Asylstrategie) sowie Digitale Verwaltung Schweiz.
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Bestandsaufnahme der KI-Regulierung durch die Kantone | | Der Bundesrat beabsichtigt, die KI-Konvention des Europarates zu ratifizieren. Zudem hat er den Auftrag erteilt, Vorschläge für die innerstaatliche Umsetzung zu erarbeiten. Eine Umfrage der KdK bei den Kantonen auf Fachebene hat ergeben, dass die vom Bundesrat eingeschlagene Stossrichtung als zweckmässig erachtet wird. Allerdings ist noch zu klären, welche Staatsebene in welchen Bereichen KI-Reglungen erlassen soll. Die Plenarversammlung hat von einem Bericht zum aktuellen Stand der KI-Regulierung in den Kantonen Kenntnis genommen. Demnach haben vier Kantone bereits erste Regulierungen zu KI erlassen, in anderen Kantonen befinden sich solche in Vorbereitung. Zudem verfügen 19 Kantone über Leitlinien zum Umgang mit KI in den Verwaltungen. Die Kantone sind sich bewusst, dass die Ratifizierung der KI-Konvention Auswirkungen auf sie haben wird, weshalb sie die gesetzgeberischen Arbeiten des Bundes aufmerksam verfolgen und die KdK wird die Umsetzung in den Kantonen aktiv koordinieren.
» Auslegeordnung
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Kantonale Integrationsprogramme 2028-32: zusätzlicher Fokus auf Frauen und Bildung | | Die Plenarversammlung hat über die Ausrichtung der nächsten Generation der kantonalen Integrationsprogramme (KIP 4) für die Jahre 2028 bis 2032 diskutiert und entschieden, zwei neue Schwerpunkte zu setzen: Zum einen soll die Integration von Frauen durch gezielte, geschlechtersensible Angebote gestärkt werden, um ihre Chancen in Bildung, Arbeit, Sprache und Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern. Zum anderen sollen die Programme unter dem Motto «Arbeit dank Bildung» das Ziel verfolgen, junge Erwachsene gezielt auf Bildungsangebote vorzubereiten und sie zu motivieren, eine Lehre zu machen oder einen Abschluss auf Tertiärstufe zu erlangen. Mit den KIP 4 wollen die Kantone die Bildungschancen von Migrantinnen und Migranten erhöhen und gleichzeitig das Fachkräftepotenzial in der Schweiz sichern.
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Handel mit den Vereinigten Staaten: Verhandlungen stehen bevor | | Die Kantonsregierungen wurden an der Plenarversammlung über den Entwurf eines Verhandlungsmandats für ein Handelsabkommen zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten informiert: Sie werden diesen nun prüfen und dem Bundesrat bei Bedarf eine Rückmeldung geben. Gleichzeitig erwarten die Kantonsregierungen, regelmässig über den Stand und Tragweite der Gespräche informiert zu werden. Der US-Markt ist für Schweizer Unternehmen von grosser Bedeutung. Deshalb besteht ein grosses Interesse daran, Unklarheiten in den Handelsbeziehungen auszuräumen.
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Olympische Spiele 2038: Lösung für die kantonale Finanzierung der Austragung der paralympischen Spiele gefunden | | Am 21. Juni 2024 entschied die Plenarversammlung der KdK, die Schweizer Kandidatur für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2038 zu unterstützen. Die entsprechenden Arbeiten kommen gut voran. Für die finanzielle Beteiligung der Kantone (60 von insgesamt 240 Millionen Franken) wurde eine Lösung gefunden: Zwischen 2027 und 2038 werden die Kantone jedes Jahr fünf Millionen Franken aus den Reingewinnen der Grosslotterien und Sportwetten an die Stiftung Sportförderung Schweiz (SFS) überweisen. Auch für die Sicherheitsvorkehrungen während der Durchführung der Spiele ist gesorgt: Die zehn direkt betroffenen Kantone haben ihre Einsatzbereitschaft bestätigt, und die KKJPD stellte an der Plenarversammlung vom 27. November 2025 sicher, dass die interkantonalen und nationalen Unterstützungssysteme verfügbar sind. Bewilligungen erfolgen wie üblich über die standardmässigen Entscheidungsprozesse.
|
| |
| |
|
|
|
|
| | Digital unterwegs – ein Einblick in Vorhaben der Digitalen Verwaltung Schweiz | | Verwaltungen bieten Leistungen digital an, um den Menschen das Leben zu vereinfachen. Die Digitale Verwaltung Schweiz (DVS) schafft den Rahmen dazu. Als Zusammenarbeitsorganisation von Bund und Kantonen schafft sie Grundlagen und fördert Projekte, die einen grossen Nutzen für die gesamte Verwaltung, die Bevölkerung und die Wirtschaft versprechen. Mit der gemeinsamen Strategie «Digitale Verwaltung Schweiz 2024–2027» treiben Bund, Kantone, Städte und Gemeinden die digitale Transformation koordiniert voran. Zur Halbzeit der Umsetzung dieser Strategie gibt die DVS Einblick in aktuelle Vorhaben und bevorstehende Projekte, die Bevölkerung, Wirtschaft und Verwaltung spürbar entlasten.
» Fokusbericht (PDF)
|
| |
| |
|
|
|
|
| | Stammtisch der Kantone: erneute Diskussion zu den Sparmassnahmen des Bundes | | Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Sparmassnahmen stossen bei den Kantonen auf Besorgnis. Die Kantonsregierungen setzen sich deshalb gemeinsam für tragfähigere Lösungen ein. Am Stammtisch der Kantone vom 2. Dezember 2025 bot sich die Gelegenheit, die Thematik vor dem Hintergrund der Beschlüsse der Finanzkommission mit Mitgliedern des Ständerats zu erörtern. Der Präsident der KdK, Markus Dieth, der Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker sowie der Präsident der Konferenz der NFA-Geberkantone, Heinz Tännler, legten dabei die Anliegen der Kantone dar.
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Generalversammlung der EUSALP in Innsbruck | | Die Makroregionale Strategie der Europäischen Union für den Alpenraum (EUSALP) führte am 25. November im österreichischen Innsbruck ihre Generalversammlung durch. Die Kantone waren durch den St. Galler Regierungsrat Marc Mächler vertreten. Im Mittelpunkt der Generalversammlung stand die Verabschiedung des neuen EUSALP-Aktionsplans, welcher die strategische Grundlage für die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren bildet. Marc Mächler informierte darüber, dass sein Kanton in Partnerschaft mit dem Land Vorarlberg einen Schwerpunkt setzen möchte bei der Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Textilindustrie. Zur Erhöhung der Sichtbarkeit und Sensibilisierung sind eine Konferenz in St. Gallen sowie eine Veranstaltung in Brüssel geplant.
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Föderalismuskonferenz: Die Schweiz zu Gast in Zug | | Rund 250 Personen nahmen am 13. und 14. November in Zug an der siebten Nationalen Föderalismuskonferenz teil. Vorträge, Podiumsgespräche und Workshops beleuchteten den zunehmenden Zentralisierungsdruck und seine Auswirkungen auf die Zukunft des Föderalismus. Im Fokus standen fünf Leitfragen: Woher kommt dieser Druck? Bedroht er das Erfolgsmodell Schweiz? Wie steht es mit der Digitalisierung in der Schweiz? Welche Parallelen gibt es zum Ausland und inwieweit kann die kantons- und gemeinde-übergreifende Zusammenarbeit eine Alternative sein zu Zentralisierung?
Die Zuger Regierungsrätin Silvia Thalmann-Gut begrüsste die aus allen Regionen der Schweiz angereisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zu den politischen Persönlichkeiten, die sich zu Wort meldeten, gehörten u.a. Bundesrat Beat Jans, Ständeratspräsident Andrea Caroni, KdK-Präsident Markus Dieth, die Präsidentin der ch Stiftung Florence Nater sowie alt Nationalratspräsidentin Gret Haller. Auch die Perspektive der jungen Generation war vertreten: Der Student Eric Schmid fasst am Ende der Konferenz seine Eindrücke zusammen und zog eine Bilanz aus Sicht der Jugend.
» Rückschau von Eric Schmid auf dem ch Blog
» Video-Rückblick
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Föderalismuspreis 2025 für den Verein «Schulen nach Bern» | | Der Föderalismuspreis wurde dieses Jahr dem Verein «Schulen nach Bern» für dessen Projekt «SpielPolitik!» verliehen. Mit diesem können die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I das Gesetzgebungsverfahren von der Anfangsidee bis zur Volksabstimmung verfolgen. Das spielerische Eintauchen in die Mechanismen der direkten Demokratie unseres Landes beginnt mit der klasseninternen Vorbereitung von Volksinitiativen, die später am Rednerpult des Nationalrats vertreten werden. Die Trophäe wurde an der Nationalen Föderalismuskonferenz überreicht.
» Mehr dazu
Der ch Blog der ch Stiftung wurde im Übrigen um einen neuen Beitrag erweitert: «Politische Übersetzung oder die Kunst, zwischen den Zeilen zu lesen». Darin erklärt der Sprachendienst der ch Stiftung und der KdK den Balanceakt, der mit seinem Auftrag verbunden ist.
» ch Blog Beitrag
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | KGRE: Treffen mit Alain Berset und Beobachtungsmissionen | | Die 49. Sitzung des Kongresses der Gemeinden und Regionen Europas (KGRE) fand vom 28. bis 30. Oktober in Strassburg statt. Die Schweizer Delegation nutzte die Gelegenheit zu einem Austausch mit Europarats-Generalsekretär Alain Berset über den Neuen Demokratischen Pakt für Europa.
Minister David Eray (JU) präsentierte seinen Bericht zu den Bürgerschaftswahlen vom 2. März in Hamburg. Zudem wurden zwei Berichte zur Umsetzung der Europäischen Charta der lokalen Selbstverwaltung vorgestellt: jener zu Moldawien von Regierungsrat Urs Janett (UR) und jener zu Griechenland von David Eray. Wahlbeobachtungen und die Überprüfung der Charta-Umsetzung bilden Kernaufgaben des KGRE; entsprechende Einsätze führten Delegationsmitglieder dieses Jahr u.a. nach Irland, Monaco und in den Kosovo.
Die Schweizer Delegation sucht zudem eine junge Person als Nachfolge von Anigna Stichelberger für das Programm «Rajeunir la politique».
|
| |
| |
|
|
|
|
| | Christelle Luisier Brodard in den Leitenden Ausschuss der KdK gewählt | | Die Waadtländer Staatsratspräsidentin Christelle Luisier Brodard ist ab Januar Mitglied im Leitenden Ausschuss der KdK. Die Plenarversammlung hat sie zur Nachfolgerin der Genfer Staatsrätin Nathalie Fontanet gewählt. Sie besetzt somit einen der beiden für die Westschweiz reservierten Sitze. Wiedergewählt wurde zudem der Berner Regierungsrat Christoph Ammann.
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Karin Kayser-Frutschi zur Vorsitzenden der politischen Begleitgruppe Schengen/Dublin gewählt | | Die Nidwaldner Regierungsrätin Karin Kayser-Frutschi übernimmt den Vorsitz der politischen Begleitgruppe der Begleitorganisation Schengen/Dublin (BOSD). Der Leitende Ausschuss der KdK hat die Präsidentin der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren für dieses Amt gewählt. Die BOSD stellt die Mitwirkung der Kantone im Bereich Schengen/Dublin sicher.
|
| |
| |
|
|
 |
|
| | Vier Kantonsvertretungen im Forum der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften der EWR/EFTA-Staaten | | Der baselstädtische Regierungspräsident Conradin Cramer sowie die Regierungs- und Staatsräte Marc Mächler (SG), Urs Martin (TG) und Frédéric Mairy (NE) werden die Kantone im Forum der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften der EWR/EFTA-Staaten vertreten. Die Plenarversammlung der KdK ernannte die Mitglieder der kantonalen Delegation, die über einen Beobachterstatus in diesem Gremium verfügt.
|
| |
| |
|
|
|
|
| Konferenz der Kantonsregierungen
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach
3001 Bern | | Kontaktieren Sie uns:
Tel. +41 31 320 30 00
» Kontakt
» Website | |
|
|
| Um die Bilder und Infografiken unseres Newsletters direkt angezeigt zu bekommen, fügen Sie die Absender-Adresse zu Ihren Kontakten hinzu.
Möchten Sie den Newsletter künftig auf Französisch erhalten, klicken Sie bitte » hier | |
|
|
| Sollten Sie kein Interesse an weiteren Newslettern haben, können Sie sich » hier abmelden | |
|
|